News
Ghosting – Zurückweisung ohne Begründung, aber nicht ohne Fürsorge
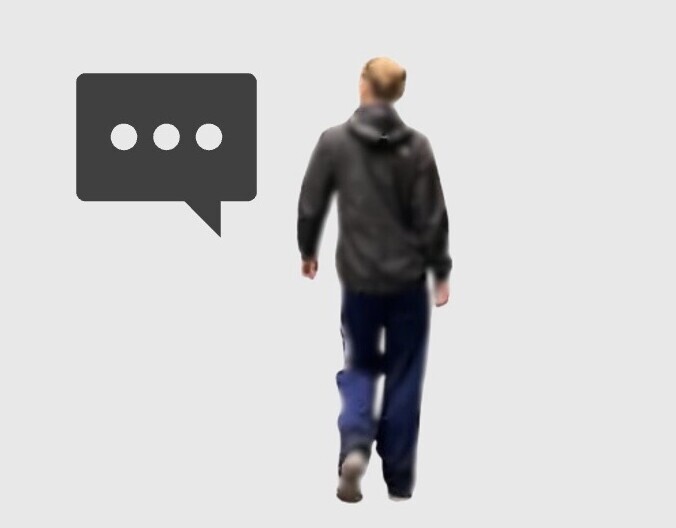
Vielleicht haben Sie das auch schonmal erlebt oder sogar selbst gemacht: plötzlich den Kontakt zu jemandem abgebrochen, ohne sich zu erklären. Dieses abrupte, einseitige Beenden der Kommunikation, um etwa eine romantische oder freundschaftliche Beziehung aufzulösen, wird heutzutage als Ghosting bezeichnet.
Ghosting ist ein weit verbreitetes Phänomen. Es fällt eben leichter, Nachrichten und Anrufe zu ignorieren, als zu erklären, dass man kein Interesse an gemeinsamen Aktivitäten hat. Besonders die Kommunikation über digitale Medien macht das Ghosting heutzutage einfach. Doch weshalb ziehen wir es manchmal vor, den Kontakt wortlos abzubrechen? Und wie nimmt das Gegenüber diese Zurückweisung auf?
Frühere Forschung zeigt, dass soziale Eingebundenheit ein menschliches Grundbedürfnis ist. Folglich wird Ablehnung meist auch als psychologisch schmerzhaft und bedrohlich für den Selbstwert erlebt. Um unseren Selbstwert zu schützen, suchen wir die Ursachen oft in äußeren Umständen und machen so andere für die negative Erfahrung verantwortlich. Auf diesen Befunden aufbauend vermuteten Forschende der New York University, dass geghostete Personen den wortlosen Kontaktabbruch auf fehlendes Mitgefühl und Selbstbezogenheit der anderen Person zurückführen.
Tatsächlich wird das Zurückweisen anderer oft als unangenehm empfunden und geht mit Schuldgefühlen einher. Das stillschweigende Beenden des Kontakts könnte also der Versuch sein, diesen negativen Gefühlen zu entgehen. Allerdings weisen bisherige Befunde auch darauf hin, dass wir uns in sozialen Beziehungen nicht nur um unser eigenes Wohlbefinden sorgen, sondern auch um das der anderen. Vor diesem Hintergrund vermuteten die Forschenden weiter, dass Ghostende nicht nur an ihr persönliches, sondern auch an das Wohl ihres Gegenübers denken. Geghostete sollten demnach die Fürsorge der Ghostenden systematisch unterschätzen.
Diese Annahmen wurde in einer Studienreihe untersucht. In einer der Hauptstudien wurden Teilnehmende zufallsbasiert in Paare eingeteilt, um online miteinander zu chatten. Nachdem sie sich kurz über Gemeinsamkeiten ausgetauscht hatten, erwarteten sie eine zweite Konversation. Einer der beiden Personen wurde dann jedoch ein Störungsbild mit der Information angezeigt, dass es technische Probleme gäbe, die erst in 20 bis 30 Minuten behoben sein würden. Die Person könne warten oder bei gleichbleibender Vergütung abbrechen. Das Gegenüber könne jedoch nicht kontaktiert werden. 79 % dieser Teilnehmenden entschieden sich für den Abbruch ohne Erklärung, also das Ghosting. Die geghostete Person wartete eine Minute im Chatraum, um dann die Information zu erhalten, dass ihr Gegenüber den Chat verlassen habe. Im Anschluss sollte die Ghostenden angeben, wie sehr sie sich für das Wohlbefinden der anderen Person interessierten. Die Geghosteten sollten einschätzen, wie sehr ihr Gegenüber an ihrem Wohlbefinden interessiert sei. Wie erwartet, waren die Ghostenden stärker am Wohlbefinden ihres Gegenübers interessiert, als von den Geghosteten angenommen.
Geghostet zu werden, bleibt ein frustrierendes Erlebnis. Der Gedanke daran, dass Personen, die ghosten, durchaus das Wohlbefinden des Gegenübers im Hinterkopf haben, kann hier hilfreich sein. Auch bei der eigenen Entscheidung zum Ghosting, sollte klar sein, dass der vermeintlich einfache Weg des Kontaktabbruchs ein Gefühl starker Ablehnung auslösen kann.
Park, Y., & Klein, N. (2024). Ghosting: Social rejection without explanation, but not without care. Journal of Experimental Psychology: General, 153(7), 1765–1789. https://doi.org/10.1037/xge0001590
Redaktion und Ansprechpartner*in¹: Bianca von Wurzbach¹, Mariela Jaffé
© Forschung erleben 2025, alle Rechte vorbehalten