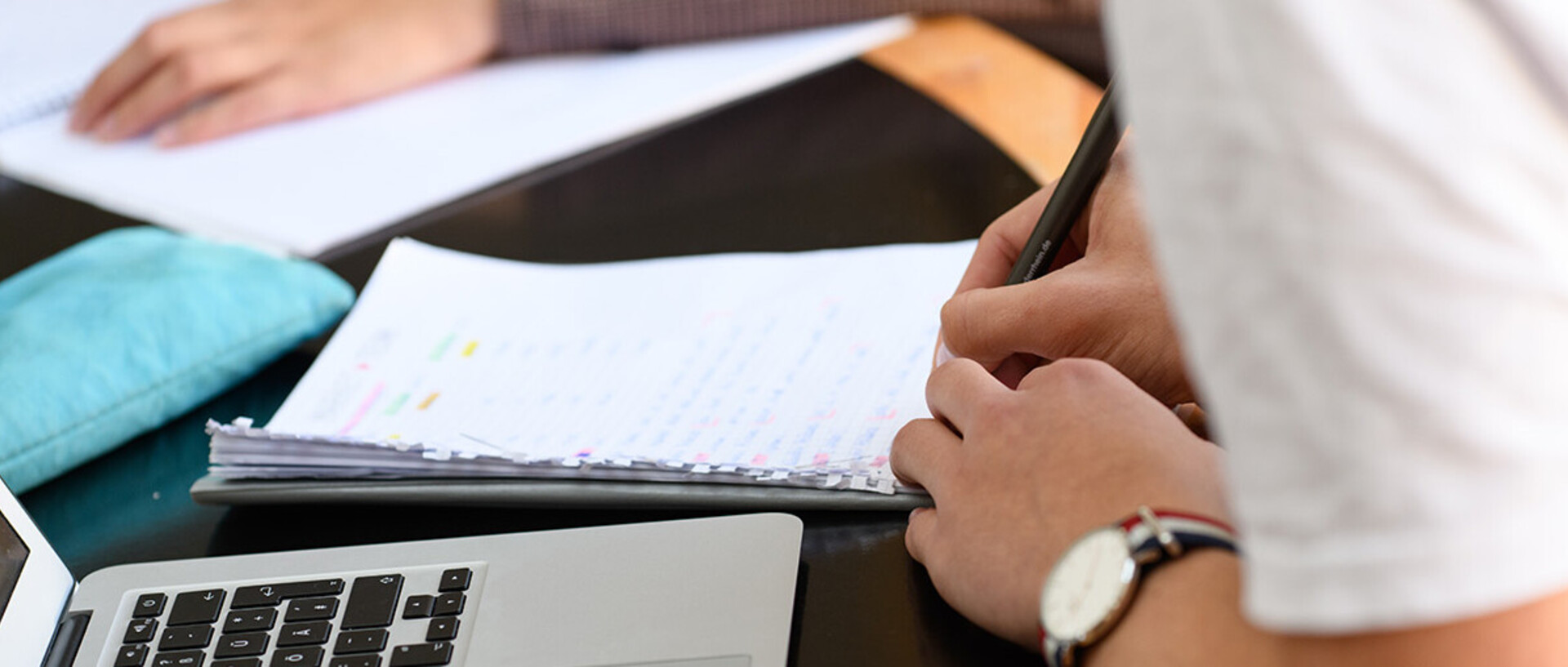Call for Papers: Medien-Misstrauen
Die Jahrestagung 2023 der DGPuK-Fachgruppe „Soziologie der Medienkommunikation“, die vom 29. November bis 1. Dezember 2023 in Mannheim stattgefunden hat, legte den Fokus auf Medien-Misstrauen. Den Call for Papers können Sie hier herunterladen.
Thema
Das Phänomen des Misstrauens erfährt in den letzten zwei Jahrzehnten im Zusammenhang mit Prozessen politischer Polarisierung große gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Dies betrifft auch die öffentliche Diskussion über die Rolle der Medien, worunter hier sowohl journalistische Nachrichtenmedien als auch Kommunikation in den sozialen Medien gefasst werden. Im wissenschaftlichen Diskurs allerdings steht Misstrauen sowohl theoretisch als auch empirisch weiterhin im Schatten des großen Bruders Vertrauen. In der Literatur finden sich hierzu hauptsächlich drei Perspektiven, wobei theoretische Konzeption, Terminologie und empirische Umsetzung nicht immer kongruent sind: Zum Ersten steht der Begriff Misstrauen synonym für ein niedriges oder nicht vorhandenes Vertrauen (z. B. Deutsch, 1960; Tsfati, 2003). Zum Zweiten gilt Misstrauen als Gegenpol von Vertrauen, der zwar über den Status von abwesendem Vertrauen hinausgeht (z. B. Hardin, 2001; Ullmann-Margalit, 2004), sich aber noch auf derselben Dimension befindet. Zum Dritten wird Misstrauen mit Luhmann (1968) nicht nur als Gegenteil, sondern auch als funktionales Äquivalent für Vertrauen und damit eigenständiges soziales Phänomen verstanden. Diese Sichtweise impliziert, dass Vertrauen und Misstrauen aufgrund unterschiedlicher sozialer Bedingungen entstehen und auch verschiedene gesellschaftliche Folgen zeitigen können. Unabhängig von einer bestimmten Perspektive sollte Misstrauen nicht vorschnell stigmatisiert werden, um auch dessen mögliche Funktionalität in den Blick zu bekommen (Mühlfried, 2019). Neben den unterschiedlichen Perspektiven auf Misstrauen gibt es eine Vielzahl von ähnlichen Konzepten, deren Beziehung zu Misstrauen klärungsbedürftig ist, wie z. B. Medienskepsis, Medienzynismus oder hostile media perception.
Die Jahrestagung 2023 wird daher den Fokus auf Medien-Misstrauen legen. Damit ist sowohl Misstrauen in Medien als auch Misstrauen durch Medien gemeint. Ziel der Tagung ist zum Ersten, aus einer mediensoziologischen Perspektive über das Verhältnis von (Medien-)Misstrauen zu verwandten Konzepten, zuallererst Vertrauen, zu reden. Damit verknüpft sind zum Zweiten Fragen nach der Rolle der Medien für die Entstehung (und Reduzierung) von Misstrauen in anderen gesellschaftlichen Bereichen, aber auch nach den Folgen von Misstrauen in die Medien selbst. Zum Dritten interessieren Fragen zur empirischen Erforschung von Misstrauen.
Konkrete Fragestellungen können sich unter anderem beziehen auf:
1. Misstrauen in Medien
Im Mittelpunkt steht hier die konzeptionelle Erörterung von Misstrauen in Medien. Mögliche Fragen betreffen das Verhältnis von Misstrauen und Vertrauen in Medien und die Abgrenzung von Medien-Misstrauen zu Konzepten wie z. B. media cynicism, Medienverdrossenheit oder Medienfeindlichkeit: Handelt es sich hierbei um distinkte Konzepte oder lassen sich möglicherweise vermeintlich unterschiedliche Begriffe zugunsten theoretischer Sparsamkeit integrieren? Von Interesse ist zudem die Frage nach der gesellschaftlichen Bedeutung von Medien-Misstrauen: Lassen sich neben dysfunktionalen auch funktionale Formen von Misstrauen identifizieren?
Willkommen sind auch Beiträge, die diese und weitere konzeptionelle Fragen ohne expliziten Medienbezug erörtern. Hierbei ist aber die prinzipielle Übertragbarkeit auf das konkrete Phänomen Medien-Misstrauen zu beachten.
2. Gesellschaftliche Bedingungen von Misstrauen in Medien
Hier geht es aus theoretischer wie empirischer Sicht um Faktoren, die zur Entstehung von Misstrauen in Medien führen. Mögliche Fragen betreffen die Bedeutung von gesellschaftlichen Krisensituationen, aber auch allgemeine Merkmale von Gesellschaften, die Misstrauen in Medien begünstigen. Daneben geht es um mögliche Auslöser im Medienbereich selbst.
3. Misstrauen durch Medien
Im Mittelpunkt steht aus theoretischer wie empirischer Sicht die Entstehung (und Reduzierung) von Misstrauen (oder verwandter Phänomene) durch mediale Kommunikation. Zudem geht es um die gesellschaftlichen Konsequenzen dieses medial mit verursachten Misstrauens. Mögliche Fragen betreffen die inhaltlichen Merkmale von Medienkommunikation, die Misstrauen in anderen Gesellschaftsbereiche begünstigen. Von Interesse sind auch strategische, z. B. rechtspopulistisch motivierte Formen medialer Misstrauensgenerierung.
4. Gesellschaftliche Folgen von Misstrauen in Medien
Angesprochen sind aus theoretischer wie empirischer Sicht die Folgen von Misstrauen in Medien (oder verwandter Phänomene) für andere gesellschaftliche Bereiche, aber auch für die Medien selbst. Mögliche Fragen betreffen unter anderem die Handlungskonsequenzen von Misstrauen in Medien, im Mediensystem selbst wie auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Hierzu zählen auch Misstrauensdiskurse zur Diskreditierung von Medien, inkl. solcher Misstrauensdiskurse, die in den Medien selbst stattfinden. Ein möglicher Aspekt ist die Thematisierung und Reflexion von Medien-Misstrauen, sowohl in den Medien selbst als auch in anderen Bereichen der Gesellschaft.
5. Empirische Erforschung von Medien-Misstrauen
Dieser Aspekt zielt auf methodische Fragen der Erforschung von Medien-Misstrauen. Mögliche Fragen betreffen die empirische Unterscheidbarkeit von Misstrauen in Medien von anderen Konzepten, die Vor- und Nachteile von qualitativen, quantitativen und Mixed-Methods-Ansätzen zur Erforschung von Misstrauen oder Strategien und Schwierigkeiten beim Feldzugang zu medienmisstrauischen und oftmals gleichzeitig auch wissenschaftsskeptischen Menschen.
Beiträge zu anderen Themen als den beispielhaft vorgeschlagenen sind willkommen, insofern sie zur grundsätzlichen Erörterung des Phänomens Medien-Misstrauen beitragen.
Erwähnte Literatur
Deutsch, M. (1960). The effect of motivational orientation upon trust and suspicion. Human Relations, 13(2), 123–139. https://doi.org/10.1177/001872676001300202
Hardin, R. (2001). Distrust. Boston University Law Review, 81(3), 495–522.
Luhmann, N. (1968). Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Enke.
Mühlfried, F. (2019). Misstrauen: Vom Wert eines Unwertes: Reclam.
Tsfati, Y. (2003). Does audience skeptizism of the media matter in agenda setting? Journal of Broadcasting & Electronic Media, 47(2), 157–176. https://doi.org/10.1207/s15506878jobem4702_1
Ullmann-Margalit, E. (2004). Trust, distrust, and in between. In R. Hardin (Hsrg.), Distrust (S. 60–82). Russell Sage Foundation.
Prozedere
Wir möchten alle Interessierten einladen, sich mit Vorträgen an der gemeinsamen Diskussion zu beteiligen. Explizit eingeladen sind auch Einreichungen von Nichtmitgliedern der Fachgruppe sowie aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Alle Einreichungen werden in einem anonymisierten Peer-Review-Verfahren begutachtet. Wichtig sind der klar erkennbare Beitrag zum Tagungsthema und die wissenschaftliche Fundierung. Hierzu gehört die präzise und nachvollziehbare Bestimmung der verwendeten zentralen Begriffe, um so eine gemeinsame Diskussion zu ermöglichen. Auch „Work in Progress“ ist willkommen, sofern dies zur Erörterung von Medien-Misstrauen beiträgt.
Wir bitten um die Einreichung von Abstracts (max. 800 Wörter ohne Literaturverzeichnis, Namensnennung nur auf Deckblatt) als PDF bis zum 3. Juli 2023 [verlängerte Frist!] via E-Mail an sozmed23uni-mannheim.de. Die Auswahlentscheidung wird am 1. September bekannt gegeben.
Zudem laden wir Kolleg*Innen ein, unabhängig vom Tagungsthema ihr Dissertationskonzept (max. 3.000 Wörter ohne Literaturverzeichnis) einzureichen. Während der Tagung gibt es im Rahmen eines „Nachwuchs“-Fensters die Möglichkeit, im Gespräch mit einer/