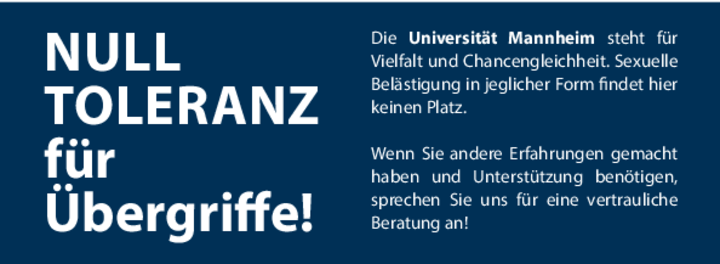Informationen und Hilfe bei Gewalt
Gewalt kann jeden Menschen treffen, in jeder Altersstufe. Sie macht vor keinem Ort der Welt und selten vor einer Position halt. Sie kann im privaten Bereich oder im Arbeitskontext auftreten – oder auch willkürlich begegnen ... weil man Teil einer marginalisierten Gruppe ist und deshalb Diskriminierung und Gewalt erfährt oder weil man zur falschen Zeit am falschen Ort war.
Gewalt zeigt dabei viele Gesichter. Oft wird unterteilt in physische, psychische, wirtschaftliche, sexuelle und online Gewalt und sexuelle Belästigung. So äußert sie sich in gewählter Sprache, in Nebensätzen fallenden Bemerkungen, durch non-verbal kommunizierte Implikationen, Witze oder offene Konfrontation. Gewalt tritt im persönlichen Kontakt, durch strukturelle Ungleichheit und mehr und mehr auch in digitaler Form auf.
Viele Betroffene nutzen die Möglichkeit zur Hilfe bei Anlaufstellen oder Beratung an der Universität Mannheim (noch) nicht. Gemeinsam können wir das Schweigen brechen, Gewalt thematisieren und auf unterstützende Angebote aufmerksam machen.
Begriffsbestimmung
Die Universität Mannheim legt Wert auf einen wertschätzenden und respektvollen Umgang. Die Senatsrichtlinie Partnerschaftliches Verhalten (PDF) regelt daher das Miteinander an der Universität.
Gewalt
- Physische Gewalt ist körperliches Verhalten, das bezweckt andere zu verletzen. Das kann zum Beispiel sein: Schubsen, Festhalten, Aussperren und so weiter.
- Psychische Gewalt findet oft verbal statt. Dabei setzt der*die Täter*in die andere Person unter Druck oder beleidigt sie. Das kann sich zum Beispiel auch in demütigen, bedrohen und ständigem kritisieren äußern. Auch Stalking, Mobbing und viele Formen von Diskriminierungen fallen unter psychische Gewalt.
- Wirtschaftliche Gewalt kann zum Beispiel sein, dass der*die Täter*in eine andere Person nicht arbeiten lässt, ihre Finanzen kontrolliert oder den Zugriff zu ihrem Konto reguliert.
- Soziale Gewalt kommt oft in Beziehungen vor und beinhaltet Dinge wie die Kontrolle der Kontakte der anderen Person und deren Isolation, oder die Freund*innen der anderen Person zurückzuweisen.
Sexualisierte Gewalt und sexuelle Belästigung
- Sexualisierte Gewalt ist oft eine Mischung aus psychischer und physischer Gewalt. Sie beinhaltet alle sexuellen Handlungen, die einer anderen Person aufgezwungen werden und demnach unerwünscht sind. Formen sexueller Gewalt reichen von sexueller Belästigung über sexuelle Nötigung bis hin zu Vergewaltigung.
- Sexuelle Belästigung wird in der Senatsrichtlinie Partnerschaftliches Verhalten (PDF) wie folgt definiert:
„ a) Sexuelle Belästigung ist jedes sexuell bestimmte Verhalten, das von der betroffenen Person unerwünscht ist und bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betroffenen Person verletzt wird. Dies können z. B. sein:
aa) Bemerkungen sexuellen Inhalts, insbesondere anzügliche Bemerkungen, Kommentare oder Witze zur Person, zu ihrem Körper, zu ihrem Verhalten oder zu ihrem Privatleben,
bb) unerwünschtes Zeigen oder sichtbares Anbringen pornographischer Darstellungen, gleichgültig in welcher Form (z. B. Kalender, Bildschirmschoner, Poster),
cc) Gesten und nonverbale Kommentare mit sexuellem Bezug,
dd) unerwünschte Aufforderungen und/oder Nötigung zu sexuellen Handlungen,
ee) unerwünschter sexuell bestimmter Körperkontakt,
ff) sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt, insbesondere unter Ausnützung von Abhängigkeitsverhältnissen am Arbeits- und Ausbildungsplatz.“
Cybergewalt
Diverse englische Begriffe bezeichnen verschiedene schädigende Formen der Belästigung, Bedrängung, Verunglimpfung, Nötigung und Verleumdung von Menschen auf digitalen Wegen über das Internet und via Smartphones. Die Übernahme einer anderen Identität, um in deren Namen zu agieren, stellt dabei eine weitere Gefahr dar.
Befragungen und Studien liefern Hintergründe zu digitaler Belästigung, unter anderem in bekannten sozialen Netzwerken. Wichtig ist es vor allem, früh aktiv zu werden, wenn man von Cybergewalt betroffen ist, sich über die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten zu informieren und diese zu nutzen.
In Baden-Württemberg bietet das Demokratiezentrum Baden-Württemberg die Möglichkeit bei Online-Hetze über die Meldestelle respect! etwas gegen Hasskommentare im Netz zu unternehmen. Auch antidemokratische und antisemitische Vorfälle können gemeldet werden.
- Zoombombing
Der Begriff verbreitete sich im Zuge der erhöhten Digitalisierung während der Coronabeschränkungen und beschreibt eine Unterbrechung von (vor allem öffentlicher) Videocalls durch unerwünschte, fachfremde Inhalte (sexualisiert, diskriminierend, rassistisch) mittels Bildschirmfreigabe. Technisches Handling zur kurzfristigen Reaktion (Entfernen der störenden Person) sowie Präventionsmöglichkeiten vor weiterem Missbrauch bei v.a. offenen Veranstaltungen sind hier wichtig, insbesondere aber auch auf psychosozialer Ebene der langfristige Umgang mit den Folgen für die Beteiligten. - Cybermobbing
Über einen längeren Zeitraum nutzen Einzelne oder eine Gruppe von Tatbegehenden Handy- oder Internetanwendungen zur vorsätzlichen Schädigung eines Opfers. Dabei besteht ein asymmetrisches Kräfteverhältnis – das Opfer kann sich schwer gegen die Handlungen der anderen wehren. Cybermobbing ist zeitlich und örtlich unabhängig und kann durch Smartphones 24 Stunden täglich stattfinden. Cybermobbing findet im Unterschied zum klassischen Mobbing mit sehr hohem Öffentlichkeitsgrad statt. Es kann in verschiedensten Formen auftreten. - Cyberstalking
Durch unangemessene, bedrohende, beleidigende, digitale Kontaktaufnahmen oder auch Verunglimpfungen in Chats, Blogs und sozialen Netzwerken werden Opfer drangsaliert. Die Überwachung von Internetaktivitäten des Opfers, Ortung von Smartphones und Identitätsmissbrauch zeigen ebenfalls die Parallelität zum klassischen Stalking. - Cybergrooming
Opfer der Altersgruppe zwischen 10 und 15 Jahren werden von Erwachsenen gezielt online auf Instagram, TikTok und Co. kontaktiert. Dabei wird bei den meist noch nicht medienmündigen Heranwachsenden eine Vertrauensbasis erschlichen und strategisch eine emotionale Abhängigkeit erwirkt, um sie zu sexualisierten Handlungen im Netz zu bringen. Anschließend kann Erpressung und evtl. auch physischer Missbrauch folgen.
- Zoombombing
Ansprechpersonen

Dipl.-Soz.päd. (FH) Alexandra Zimmermann (sie/ihr)
Stabsstelle Gleichstellung und Diversität
B 6, 30–32 – Raum 014
68159 Mannheim

Prof. Dr. Georg W. Alpers
Otto-Selz-Institut
L 13, 17 – Raum 208
68161 Mannheim
Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württembergs (MWK) bestellte die Rechtsanwältin Michaela Spandau aus Stuttgart als Vertrauensanwältin für den Bereich sexualisierte Diskriminierung, sexuelle Belästigung und Gewalt für die Einrichtungen im Geschäftsbereich des MWK.
- Die Initiative der Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten LaKoG hat die Kampagne „Zieh einen Schlussstrich“ gegen sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen in Baden-Württemberg ins Leben gerufen.
- Der Präventionsverein SiMA bietet Selbstbehauptungskurse an. Auch das Institut für Sport der Universität Mannheim bietet Kurse zur Selbstbehauptung und -verteidigung für Sie* an.
- Videovortrag von Tanja Kramper, Geschäftsführerin der Kommunalen Kriminalprävention Rhein-Neckar e. V., über die wichtigsten Fakten zu Gewalt in der Region und Tipps im Umgang mit gefährlichen Situationen.
- Vortrag zu Cybermobbing mit Hintergrundinformationen, Möglichkeiten der Prävention und Intervention von Tanja Kramper, Geschäftsführerin der Kommunalen Kriminalprävention Rhein-Neckar e. V.
Anlaufstellen
Um im Notfall richtig reagieren zu können, ist es wichtig, relevante Schritte im Ernstfall im Hinterkopf zu behalten. Die Polizei bietet Schutz bei akuter Bedrohung unter der 110 sowie prägnante Opferinformationen mit wichtigen ersten Schritten zu verschiedenen Themen
Schnelle Hilfe im AKUTFALL
- Vertrauliche Spurensicherung
Die Spurensicherung kann ohne Hinzuziehen der Polizei und ohne Anzeige durchgeführt werden. Es gilt die ärztliche Schweigepflicht, sämtliche Mitteilungen werden vertraulich behandelt und nur nach expliziten Einverständnis an Ermittlungsbehörden weitergegeben. Betroffene von Vergewaltigungen oder sexueller Gewalt scheuen häufig unmittelbar nach der Tat die Anzeigeerstattung oder haben Schwierigkeiten direkt zu entscheiden zur Polizei zu gehen. Für ein mögliches späteres Gerichtsverfahren ist es jedoch wichtig, zeitnah nach der Gewalterfahrung Befunde und Spuren fachkundig zu dokumentieren und zu sichern.- Gewaltambulanz Heidelberg
Die Ambulanz steht nach telefonischer Terminabsprache unter +49 152 5464 8393 rund um die Uhr zur Verfügung. Mitarbeitende unterliegen der Schweigepflicht und Absprachen zu Ort/Termin der Untersuchung erfolgen zeitnah nach telefonischem Vorgespräch.
- Gewaltambulanz Heidelberg
- Hilfetelefon„Gewalt gegen Frauen“ unter 08000 116 016 und online
- Hilfetelefon „Gewalt an Männern“ unter 0800 123 99 00 und online
- Telefonsprechstunde für Frauen und Mädchen aus der Ukraine
Der Frauennotruf in Heidelberg bietet eine neue Telefonsprechstunde auf Ukrainisch, Russisch, Englisch und Deutsch an. Das Angebot richtet sich an Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die aus der Ukraine geflüchtet und von sexualisierter Gewalt betroffen sind.
Telefonsprechstunde: donnerstags von 13 bis 14 Uhr unter der Nummer 06221 183643
Sie ist als Erstkontakt und zur Vereinbarung eines Beratungstermins gedacht. Weitere Informationen finden Sie im Flyer (PDF, 153 kB). - Weisser Ring mit Online-Angeboten und Opfer-Telefon unter 116 006
- Hilfetelefon bei sexuellem Missbrauch für Erwachsene und Jugendliche: 0800 22 55 530
- Relevante Notfallkontakte in einer Zusammenfassung des Deutschen Präventionstags
- Frauen- und Mädchennotruf Mannheim
Telefon: 0621/10033 oder teammaedchennotruf.de - Luisa richtet sich als Hilfsangebot an Frauen in der Partyszene von Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen, die sich mit der Frage „Ist Luisa hier?“ ans Personal wenden können und unmittelbar und diskret Hilfe in unangenehmen Situationen bekommen.
- Vertrauliche Spurensicherung
Unterstützung bei häuslicher Gewalt
- Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bei häuslicher Gewalt bietet u. a. telefonische Beratung, Sofort-Chat und Online-Beratung
- Hilfen bei häuslicher Gewalt der Stadt Mannheim
- Die Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (ZIF) bietet tagesaktuell und öffentlich einen bundesweiten Überblick über die Aufnahmekapazität der registrierten Frauenhäuser und Schutzwohnungen, in denen Schutz und Unterstützung erhalten werden kann.
- Fraueninformationszentrum (FIZ) Mannheim
Schutz, Hilfe und Beratung für Frauen und deren Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben. Telefon: 06 21 / 37 97 90, Email: - Mannheimer Frauenhaus
Schutz, Hilfe und Beratung für Frauen und deren Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben. Telefon: 06 21 / 74 42 42, Email: - Frauen- und Kinderschutzhaus Heckertstift Mannheim
Schutz und Unterkunft für Frauen und deren Kinder, die sexuelle, körperliche oder seelische Gewalt erlebt haben. Telefon: 0621/411068 oder über die kostenlose Hotline 0800 1008121; Email: - Die Beratungs- und Interventionsstelle Lida des Diakonischen Werks Rhein-Neckar-Kreis unterstützt mit Informationen und Vermittlung weiterer Hilfs- und Beratungsangebote Frauen nach häuslicher Gewalt. Als Anlaufstelle für den nördlichen Rhein-Neckar-Kreis dient eine Außenstelle in Heidelberg.
- Frauen helfen Frauen berät als Interventionsstelle Frauen und Mädchen auch mittels Dolmetscherin, die akut Gewalt in ihrer Beziehung erleben und die dringend Unterstützung benötigen (Koordinierungs- und Anlaufstelle im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes und im Wohnungsverweisverfahren; weitere Schwerpunkte sind Stalking und Themen der selbstbestimmten Lebensführung/Zwangsheirat). Telefon: 06221/
750 135, Email: infointerventionsstelle-heidelberg.de - Stärker als Gewalt – häusliche Gewalt erkennen mit Informationen, Tipps und rechtlichen Hintergründen
- Für den Raum Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis bietet das Projekt guide4youUnterstützung, um betroffene Frauen* durch persönliche Begleitung das örtliche Hilfesystem bei häuslicher Gewalt zu verbessern. Bis Juli 2021 steht in 8 Sprachen zudem auch ein anonymer Fragebogen zur Verfügung, anhand dessen Ergebnis das Hilfesystem an die Bedarfe von Frauen* angepasst wird.
Hilfe bei Online-Hetze und Stalking
- Beim Demokratiezentrum Baden-Württemberg können Sie Online-Hetze, antisemitische und antidemokratische Vorfälle melden
- Die NO STALK App des Weissen Rings hilft, Stalking-Vorfälle per Foto-, Video- sowie Sprachaufnahmen mit dem Smartphone zu dokumentieren.
- Psychotherapeutische Spezialambulanz für Stalking-Opfer am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim unter 0621 1703-2850, nennen Sie das Stichwort „Stalking“
- Strategien und weitere hilfreiche Tipps zum Umgang mit Gewalt im Netz mit einem Überblick zu juristischen und technischen Fragen bieten allgemeine Unterstützung im Fall der Fälle. Mit individueller Beratung unterstützen bei Problemen neben hateaid.org auch Anlaufstellen der sozialpsychiatrischen Dienste der Gesundheitsämter vor Ort sowie die Telefonseelsorge – und im Notfall zum Schutz auch die Polizei.
Traumaberatung
- BEKO Rhein-Neckar Traumaberatung
Fachberatungsstelle für Menschen, die von einem hoch belastenden Ereignis betroffen sind. Zu diesen belastenden Ereignissen gehören z. B. Wohnungseinbruch, Betrug, Gewalt, Unfälle, Suizid eines nahestehenden Menschen oder andere Unglücksfälle. Das Beratungs- und Informationsangebot ist kostenlos, auf Wunsch anonym und weltanschaulich neutral. - Psychologische Beratungsstelle Frauen und Mädchennotruf
Die psychologische Beratungsstelle ist neben Hilfe in Akutfällen beratend für sexuell misshandelte Frauen und Mädchen, unterstützende Bezugspersonen und Fachkräfte tätig. Sie bietet unter der Nummer 0621 10033 oder via Email teammaedchennotruf.de Beratungen und Traumatherapie, juristische Informationen, Elterngespräche, u.v.m. - Trauma- und Opferberatung Seehaus e. V. Sinsheim
Termine können bei der Trauma- und Opferberatung von Seehaus e. V. Sinsheim kostenlos vereinbart werden: oder oder telefonisch unter 07261 94 35 521.
- BEKO Rhein-Neckar Traumaberatung
Beratung für Kinder und Jugendliche
- Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche: 116 111
- Psychologische Beratungsstelle Frauen und Mädchennotruf
Die psychologische Beratungsstelle ist neben Hilfe in Akutfällen beratend für sexuell misshandelte Frauen und Mädchen, unterstützende Bezugspersonen und Fachkräfte tätig. Sie bietet unter der Nummer 0621 10033 oder via Email teammaedchennotruf.de Beratungen und Traumatherapie, juristische Informationen, Elterngespräche, u.v.m. - LuCa Heidelberg e. V.
Geschlechtssensible Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu Gewaltprävention, Ess-Störungen, Jugendberufshilfe u. a. - Childhood-Haus Heidelberg
Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt geworden sind. Telefon: 06221/56-32430, Email: Childhood-Hausmed.uni-heidelberg.de - Selbsthilfe-Plattformjuuuport der Niedersächsischen Landesmedienanstalt
Ausgebildete, ehrenamtliche Scouts zwischen 14 und 18 Jahren beraten Jugendliche bei schlechten Erfahrungen im Internet
Beratung für Tatgeneigte
- Jedermann e. V. Mannheim
Beratung für Täter*innen und Tatgeneigte. Handy und Whatsapp-Kontakt: 0179/4883083, 0179/ 7308238; Email: - Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW)
Telefonische therapeutische Hilfestellungen für Menschen, die befürchten, eine Straftat zu begehen. Insbesondere Personen mit sexuellen Phantasien gegenüber Kindern oder zu Gewalttaten neigende Personen können dieses kostenlose und anonyme Angebot unter der bundesweit kostenfreien Hotline nutzen: 0800 70 222 40. - Männerinterventionsstelle/Männer Notruf Fairmann e. V.
in Heidelberg bietet vorurteilsfreie, anonyme Telefon- und Internetberatung für Männer, die Gewalt ausgeübt haben oder noch ausüben. Telefon: 06221 600101, Email: infofairmann.org
- Jedermann e. V. Mannheim
Weitere Beratungsstellen mit unterschiedlicher, spezifischer Ausrichtung (LSBT*I*Q+)
- Beratung LSBTTIQ Baden-Württemberg
Zentrales Netzwerk zum Finden von Beratungsstellen in Baden-Württemberg - PLUS. Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar
Beratung für lsbttiq Menschen und ihre Angehörigen, auch zum Thema Gewalt und Gewaltprävention; Telefon: 0621 / 33 62 110, Email: teamplus-mannheim.de - trans*support | Fachstelle für trans* Beratung und Bildung e. V.
berät u. a. zu Anliegen wie Erfahrungen mit Diskriminierungen, Hasskriminalität und Gewalt. Opfer von Diskriminierung und Hasskrimininalität könnenhier Vorfälle anonym melden. - pro familia Mannheim
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungen, Ehe-Familie-Lebensberatung, Jugendsprechstunde; Telefon: 0621-27720 - AIDS-Hilfe Heidelberg e. V.
Beratung und Information zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Eine anonyme Telefonberatung findet unter 06221/19 4 11 statt, ansonsten auch per Email: infoaidshilfe-heidelberg.de - Beratungsstellen der örtlichen Polizeibehörde
zu diversen Themen des Opferschutz und der Prävention
- Beratung LSBTTIQ Baden-Württemberg
Informationen für Bystander/
Vertrauenspersonen Empathische Unterstützung ist für Opfer von Gewalt von erheblichem Wert. Ein Übergriff stellt einen massiven Kontrollverlust für die betroffenen Personen dar. Reaktionen und Bedürfnisse können ganz unterschiedlich ausfallen. Wichtig ist daher im Kontakt, das individuelle Anliegen gewünschter Unterstützung der betroffenen Person zu erfragen und zu respektieren. Dies betrifft sowohl das Gespräch mit Kontext, Inhalten und Dauer, sowie potenzielle weitere Handlungen.
Aktiv und wertfrei zuzuhören, der betroffenen Person zu glauben und nichts über deren Kopf hinweg zu entscheiden, sind gute Grundlage für vieles Weitere. Sorgen Sie dabei auch selbst gut für sich und suchen Sie Unterstützung bei vertraulichen Fachberatungsstellen, um mit der Situation für sich selbst umgehen zu können.
Wichtig für den Beginn sind folgende Aspekte:
- Für eine vertrauliche Spurensicherung steht die Heidelberger Gewaltambulanz zur Verfügung.
- Eine gute Dokumentation des Hergangs, Ort, Zeit und beteiligter Personen (Zeug*innen) ist wertvoll. Gerne darauf aufmerksam machen!
- Zu weiteren Anlauf- und Fachberatungsstellen informieren, die Vertraulichkeit sichern. Gerne eine Begleitung zu diesen oder zur medizinischen Versorgung anbieten.
- Gemeinsame Überlegungen zu geeigneten primären Schutzmaßnahmen sind möglich, aber auch durch fachliche Expertise ergänzbar.
- Eine Meldung bei offiziellen Stellen (Polizei, Universität (Vorgesetzte, Lehrende, Justitiariat, Personalabteilung, Rektorat und Kanzlerin, …) oder weitere offizielle Schritte sollten nur mit Einverständnis der betroffenen Person gegangen werden!
Informationsmaterialien des Frauen gegen Gewalt e. V. oder das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter 08000 116 016 bieten weitere Orientierung, wie Unterstützung aussehen kann.
Informationen und weiterführendes Material
Flyer und Informationsbroschüren
Cybergewalt:
- Stadt Berlin – Ihr gutes Recht bei Cyberstalking (PDF)
- Stadt Berlin – Cyberstalking aktiv werden
- Frauen gegen Gewalt – Digitale Gewalt
- Polizeiberatung Informationen zum Opferschutz – Cybercrime
- Aktion tu was... gegen Cybermobbing
Sexualisierte Gewalt/
KO Tropfen - Frauen gegen Gewalt – Infoflyer für Betroffene und Bezugspersonen bei sexualisierter u. häuslicher Gewalt, Belästigung am Arbeitsplatz, Stalking
- Pro Beweis – KO Mittel (PDF)
- Polizeiberatung Information zum Opferschutz – sexuelle Gewalt/
KO Tropfen (PDF)
Häusliche Gewalt/
Körperverletzung: - Polizeiberatung Information zum Opferschutz – häusliche Gewalt
- Polizeiberatung Information zum Opferschutz – Körperverletzung
Stalking:Videos
- Reaktion Ursula von der Leyen zum „Sofagate“ in der Türkei
- Einblick in das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
- Weisser Ring: Sexualisierte Gewalt
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu Digitaler Gewalt
- Joko und Klaas „Männerwelten – Belästigung von Frauen“
- Polizei Mannheim: Notruf absetzen
- Mannheim sagt NEIN zu Gewalt an Frauen und Mädchen 2020
„Reicht das schon…?“ Wie kann sich sexuelle Diskriminierung äußern? Fallbeispiele aus dem universitären Kontext
Apps
Die NO STALK App des Weissen Rings hilft, Stalking-Vorfälle per Foto-, Video- sowie Sprachaufnahmen mit dem Smartphone zu dokumentieren.
Initiativen
- Initiative des Bundesfamilienministerium „Stärker als Gewalt“ www.stärker-als-gewalt.de mit Informationen zu häuslicher, digitaler und sexualisierter Gewalt, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, Stalking und Mobbing.
- Stark für Frauen und gegen Gewalt macht sich auch der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe mit Aktionen, Hilfsangeboten und Informationsmaterial.
- Sexismus und Gewalt – am Arbeitsplatz und darüber hinaus – Frauen.VERDI – Sexismus und Gewalt
Studien
Besonders für Gewalt gegen Frauen gibt es eine gute Datenlage und spezialisierte Hilfsstrukturen. Gefürchtete Settings wie einsame Parkhäuser, schlecht beleuchtete Straßenzüge oder Parks sind durchaus reale Orte von Übergriffen und Vergewaltigungen. Eine größere Bedrohung stellt jedoch der soziale Nahraum für Frauen dar: jede 4. Frau erlebt laut Studie des BMFSFJ, Gewalt gegen Frauen (PDF), 2004, Gewalt in der eigenen Beziehung durch den Partner.
Gewalt an Frauen in Zahlen:
- Angaben von Statista zu Gewalt gegen Frauen
- Statistik des Bundeskriminalamtes zur Partnerschaftsgewalt
Neuere Studien zeigen allerdings, dass das größte Risiko für Menschen besteht, die Teil einer marginalisierten Gruppe sind, also zum Beispiel besonders nicht-binäre und trans* Menschen, Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, Menschen, die Teil einer ethnischen Minderheit sind, und Menschen, die Teil der LSBT*I*Q+ Community sind. Leider ist in diesen Bereichen die Datenlage noch nicht so gut wie in Bezug auf Frauen.
Folgende große Studien bieten wissenschaftliche Erkenntnissezum Thema Gewalt und Sicherheit:
Dunkelfeldstudie zu Sicherheit und Gewalt
Durchgeführt vom Bundeskriminalamt und den Polizeien der Länder:
- Studie „Sicherheit und Kriminalität in Deutschland“
- Ergebnisse zeigen, dass vor allem Frauen ihre Bewegungsfreiheit aus Angst vor Gewalt und Übergriffen einschränken und Sicherheitsvorkehrungen treffen
Gewalt im Hochschul-/Arbeitskontext
- Größte Europäische Studie zu gender-basierter Gewalt des Leibniz Instituts für Sozialwissenschaften im Rahmen des EU-Projekts UniSAFE. Betrachtet wurden Erfahrungen in Lehre und Forschung an 46 Hochschulen und Forschungseinrichtungen (2022):
- 62% der Befragten gaben an mindestens eine Form gender-basierter Gewalt erfahren zu haben: 66% der Frauen, 56% der Männer und 74% der nicht-binären Befragten
- Am häufigsten waren Menschen von psychischer Gewalt betroffen (57%), gefolgt von sexueller Belästigung (31%), und wirtschaftlicher Gewalt (10%). 8% der Befragten hatten online Gewalt erlebt, 6% pysische Gewalt und 3% sexuelle Gewalt.
- Menschen mit Behinderungen oder chronischer Erkrankung, Menschen, die Teil einer ethnischen Minderheit sind, und Menschen, die Teil der LGBTQIA+ Community sind, sind öfter von gender-basierter Gewalt betroffen als able-bodied, weiße, heterosexuelle Menschen
- Nicht-binäre Menschen waren verglichen mit allen anderen analysierten Gruppen, diejenigen mit dem höchsten Risiko von mindestens einer Form von gender-basierter Gewalt betroffen zu sein
- Quantitative und qualitative Studie im Hochschulkontext an 16 ausgewählten Hochschulen Deutschlands: gendercrime country report germany (PDF) 2009–2011
- 54,7% der weiblichen Studierenden gaben an, im Studium sexuelle Belästigung erlebt zu haben
- Veröffentlichung der Universität Halle zu Sexueller Gewalt an Hochschulen (PDF) (2015)
- Weitere Studienergebnisse sind auch im Portal des Leibniz Instituts für Sozialwissenschaften zu finden: CEWS – geschlechtsbezogene und sexualisierte Gewalt in der Wissenschaft
Die Studie Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zeigt, dass im Laufe des gesamten Arbeitslebens circa jede vierte bis fünfte Frau und jeder zwölfte bis vierzehnte Mann sexuelle Belästigung im Arbeitskontext erlebten.
- Größte Europäische Studie zu gender-basierter Gewalt des Leibniz Instituts für Sozialwissenschaften im Rahmen des EU-Projekts UniSAFE. Betrachtet wurden Erfahrungen in Lehre und Forschung an 46 Hochschulen und Forschungseinrichtungen (2022):
Studie der Lesbenberatung Berlin und LesMigraS
Eine quantitative und qualitative Studie der Lesbenberatung Berlin und LesMigraS zu Gewalt an lesbischen, bisexuellen Frauen und trans* Menschen in Deutschland (PDF) (2012), die diese Gruppe besonders häufig betrifft. Die Ergebnisse werden von einer Analyse der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu Diskriminierungserfahrungen in Deutschland anhand der sexuellen Identität (2017) in quantitativen und qualitativen Daten bestätigt.
Besonders häufig sind trans* Personen von sexueller Diskriminierung und Gewalt betroffen.
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA)
Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) führte 2014 eine europaweite Studie (PDF) zu Erfahrungen von körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt an Frauen durch.
Allgemein zeigt sich, dass in der EU Gewalt gegen Frauen weit verbreitet ist und Deutschland sich im Vergleich im mittleren bis hohen Bereich befindet. 24% der Befragten gaben für Deutschland an, seit dem 15. Lebensjahr Stalking erfahren zu haben. 60% der Teilnehmenden haben mindestens eine Form der sexuellen Belästigung erlebt.
Studien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
Zwei repräsentative Studien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geben einen allgemeinen Einblick in Gewalt gegen Frauen in Deutschland (2004) und speziell die Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland (2011).
Ausgewählte Inhalte aus 2004:
- 42% der Frauen haben psychische Gewalt erlebt
- 40% haben seit dem 16. Lebensjahr körperliche und/
oder sexualisierte Gewalt erfahren - jede 4. Frau erlebt häusliche Gewalt in der eigenen Beziehung durch den (ehemaligen) Partner
- 13% haben seit dem 16. Lebensjahr eine strafrechtlich relevante Form von sexualisierter Gewalt erfahren
- 37% der Frauen, die von körperlicher Gewalt betroffen waren und 47% derer, die sexuelle Gewalt erlebten, hatten mit niemandem über diese Erfahrungen gesprochen
Häusliche Gewalt während der Corona-Einschränkungen im Frühling 2020
Eine Anfang Juni 2020 erschienene, erste große deutsche Studie der TU München für die Zeit des Lockdowns zeigt:
- 3,1% der Frauen erlebten körperliche Gewalt
- 3,6% erlitten sexuelle Gewalt
- 3,8% erlebten psychische Gewalt, davon durften 2,2% das Haus nicht ohne Erlaubnis verlassen und bei 4,6% regulierte der Partner Kontakte mit anderen Personen – auch digital.
Nutzung der Unterstützungsangebote während der Corona-Einschränkungen im Frühling 2020
Die Studienergebnisse der TU München vom Juni 2020 zeigen, dass bestehende Hilfsangebote während des Corona-Lockdowns nur wenig genutzt wurden
- „48,2% der Opfer kannten die Telefonseelsorge, 3,9% hatten dort angerufen.
- 32,4% kannten das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“, 2,7% hatten sich dorthin gewandt.
- 44,3% kannten das Elterntelefon, 21,5% hatten dort Hilfe gesucht.
- 5,5% kannten die Aktion „Codewort Maske 19“, bei der Apotheken die Behörden verständigen, wenn eine Kundin dieses Codewort sagt. 1,8% hatten diese Möglichkeit genutzt.“ (Zitat: idw-Online, letzter Aufruf 20.10.2020)
Digitale Gewalt
Befragung von Plan International zu digitaler Gewalt:
Im Welt-Mädchenbericht 2020 zu digitaler Gewalt gegen Mädchen und Frauen von Plan International wurden 14.000 junge Frauen und Mädchen aus 22 Ländern befragt:
- 58% erlebten weltweit Bedrohungen, Beleidigungen und Diskriminierungen in sozialen Medien.
- 70% der deutschen Befragten gaben an, derartige Belästigungen in sozialen Medien erlebt zu haben
- 50% der Mädchen gaben an, mehr in sozialen Medien als auf der Straße Belästigungen zu begegnen
- Weltweit führende Plattformen in punkto Belästigung sind Facebook (39%) und Instagram (23 %)
Studie von Amnesty International 2017:
Schon Ende 2017 befasste sich die Menschenrechtsorganisation mit den Erfahrungen von Frauen zu digitaler Gewalt und Belästigung im Internet und social media Plattformen. Von den repräsentativ ausgewählten 500 Frauen zwischen 18 und 55 Jahren aus den USA, Neuseeland, Großbritannien, Schweden, Dänemark, Italien, Spanien und Polen gaben an:
- Ca. 23% hatten schon einmal kritische Kommentare erhalten
- 41% der Befragte, die bereits digitale Gewalt erlebt hatten, fühlten sich tatsächlich physisch bedroht – 24% fürchteten auch um ihre Familien
- Über 50% entwickelten in Folge verschiedene psychische Beschwerden (Beeinträchtigung des Selbstbewusstseins, Schlaf- und Konzentrationsprobleme bis hin zu Panikattacken und Angstzuständen)
- 59% gaben an, die digitale Gewalt ging dabei von Unbekannten/
Fremden aus - 76% berichteten aufgrund dieser Erfahrungen anders im digitalen Alltag aufzutreten
- Nur 18% der befragten Frauen konnten über adäquate und positive Reaktionen der sozialen Plattformen auf ihre Beschwerde hin berichten
Cybermobbing und Cybergrooming:
Zwei Dunkelfeldstudien zu Cybermobbing und Cybergrooming aus dem Jahr 2011 unter Jugendlichen, des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) Bielefeld und der Forsa-Umfrage „Cybermobbing – Gewalt unter Jugendlichen“, ergaben unterschiedliche Prävalenzraten von Opfer- und Zeugenangaben. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die Forsa-Umfrage die Lebenszeitprävalenz von Cybermobbing untersuchte, wohingegen die IKG-Studie eine Drei-Monats-Prävalenz ermittelte.
- IKG-Studie (Befragung durch offen zugänglichen Online-Fragebogen für den Zeitraum Februar bis Juli 2011 unter 11 bis 24-jährigen Schülern):
- 14,1 % der Schüler waren in den letzten 3 Monaten Opfer mindestens einer Form von Cybermobbing geworden (belästigendes und rufschädigendes Verhalten, Cyberstalking und sexuelle Belästigungen). 15,1% der Schülerinnen und 12,8% der Schüler gaben an, Opfer gewesen zu sein.
- 12,6 % der Befragten waren innerhalb der letzten drei Monate selbst Täter*innen in mindestens einer Form von Cybermobbing. 13,2 % der Schülerinnen berichteten, selbst Cybermobbing begangen zu haben, ebenso 11,9% der Schüler. Männlich Cybermobber begehen jedoch durchschnittlich häufiger verschiedene Taten.
- Forsa Umfrage (Telefonische Umfrage unter 14 bis 20-Jährigen):
- 32 % der befragten Jugendlichen waren schon mal Opfer von Cybermobbing
- 8 % gaben an, selbst als Täter*in schon einmal Cybermobbing verübt zu haben
- 78 % der Befragten kennen selbst ein Opfer von Cybermobbing