Menschenrechte im Stresstest
Seit 2010 hat Prof. Dr. Sabine Carey den Lehrstuhl Politikwissenschaft, Internationale Beziehungen an der Universität Mannheim inne, obendrein ist sie die Direktorin des Mannheimer Zentrums für Europäische Sozialforschung (MZES). In einem breit angelegten Forschungsprojekt untersucht sie derzeit mit ihrem Team an der TU München und der University of Southampton die Einstellung der Bevölkerung zu Menschenrechten.
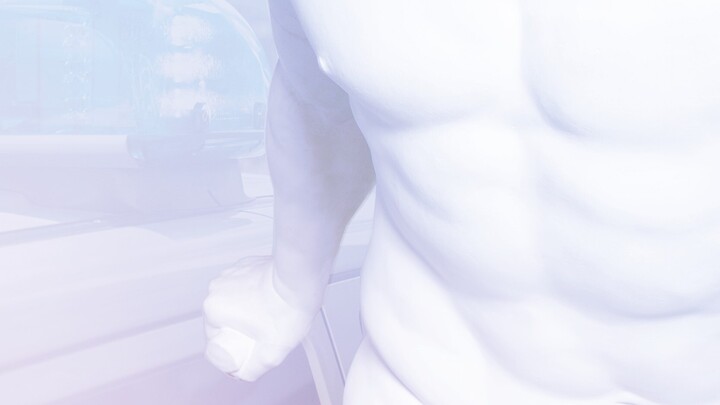
Klickt man sich durch die Webseite von Prof. Dr. Sabine Carey, wird rasch deutlich, wie fleißig am Lehrstuhl Politikwissenschaft, Internationale Beziehungen gearbeitet wird. Schon der Lebenslauf der 51-Jährigen liest sich respekteinflößend: Doppelabschluss an der Universität Konstanz und der University of North Texas, Promotion an der University of Essex, einjährige Forschungstätigkeit an der Harvard University. Bevor sie dem Ruf nach Mannheim folgte, arbeitete sie acht Jahre an der University of Nottingham. Carey wird gern als Konfliktforscherin bezeichnet, sie widmet sich Themen wie staatlichem Terrorismus und Aufstandsbekämpfung. Jedes große Forschungsprojekt hat auf der Webseite der Politikwissenschaftlerin einen eigenen Reiter, neben den Reitern „Regierungsnahe Milizen“ oder „Morde an Journalist*innen“ findet sich einer mit dem Titel „Wahrnehmung der Menschenrechte“.
Für drei Jahre ist dieses von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projekt angesetzt, es läuft noch bis Ende 2026. „Wir möchten die Einstellung der Bevölkerung in Deutschland zu Menschenrechten untersuchen und herausfinden, ob und wie die Unterstützung für die Menschenrechte in Krisenzeiten gestärkt werden kann“, erklärt Carey das Projektziel. Mittels innovativer Umfrageexperimente sammelt das Team seine Daten und startete im August 2024 eine erste Umfragewelle, an der über 6.000 Menschen teilnahmen. „Bei dieser ersten Umfrage ging es uns zunächst ganz generell darum, zu untersuchen, welche Menschen sich eher für oder gegen den Schutz von Menschenrechten aussprechen – und was sie überhaupt unter Menschenrechten verstehen“, erläutert die Professorin ihr Vorgehen.
Sachliche Argumente helfen
Und so entwarf das Forschungsteam zum Beispiel das Szenario einer Demonstration: In dem fiktiven Szenario wurde die Polizei gegenüber den friedlichen, aber sehr wohl lauten und den Verkehr lahmlegenden Demonstrierenden übergriffig. Nun sollten die Befragten darüber entscheiden, ob diese Polizeigewalt straffrei bleiben sollte. Die Gruppe der Demonstrierenden wurde dabei wahlweise als rechte Gruppe, muslimische Gruppe oder Klimaaktivisten betitelt. „Es hat sich ganz klar herauskristallisiert: Wenn die Befragten die Demonstrierenden als Outgroup betrachten – also als eine Menschengruppe, die sie nicht mögen –, dann sind sie eher willens, die Rechte dieser Gruppe einzuschränken“, fasst Carey zusammen.

Umso überraschender dann aber: Gerade die Befragten, die sich am vehementesten für die Akzeptanz der Polizeigewalt aussprachen, waren dann im Nachgang am einfachsten wieder umzustimmen. „Als wir im Anschluss an das Szenario betonten, dass die Straffreiheit der exzessiven Polizeigewalt eine Verletzung des Grundrechtes sei, da alle in einer Demokratie das Recht darauf haben, friedlich zu demonstrieren, haben diese Befragten sich mehrheitlich umentschieden“, so Carey. Ihre Erklärung: Sehen sich Menschen einer konkreten Gefahr ausgeliefert, sind sie schnell dabei, die Rechte bestimmter anderer Menschengruppen einzuschränken – aus einem Bauchgefühl heraus und mit Blick auf den kurzfristigen Nutzen. Die gute Nachricht: Laut Careys Umfragen hilft es durchaus, stetig daran zu erinnern und immer wieder sachlich zu erklären, dass man sich die Menschenrechte nicht verdienen muss, sondern dass sie allen zustehen – ganz gleich, welcher Herkunft, welchem Glauben oder welcher politischen Meinung jemand ist.
Zwei andere Ergebnisse hingegen sieht die Professorin weniger positiv. Zum einen ist da die generelle Einstellung zu Kompromissen: Über 50 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Kompromisse in der Politik eher oder komplett als Verrat am eigenen Volk sehen. „Es ist natürlich hochproblematisch für eine Demokratie, wenn die Mehrheit der Menschen Kompromisse in der Politik schlecht findet. Dann ist es kein Wunder, wenn Koalitionsregierungen zusammenbrechen, weil Politiker*innen nicht so scharf darauf sind, Kompromisse einzugehen – in dem Wissen, das kommt bei ihren Wähler*innen nicht gut an“, kommentiert Carey.
Sorgen bereitet der Wissenschaftlerin zudem ein weiteres Ergebnis. Bei der Frage, ob es besser sei, man habe eine*n Anführer*in, der*die einem sagt, was man tun oder lassen soll, haben 24 Prozent der Menschen dem zugestimmt oder eher zugestimmt. Bei den 18- bis 26-Jährigen war es sogar über ein Drittel der Befragten. „Wir haben mit dem Wort ‚Anführer*in‘ schon eine harte Formulierung benutzt und ich fand es enorm erschreckend, wie viel Zustimmung dann kam“, betont Carey. Nun gelte es wissenschaftlich zu beobachten, ob die Antwort etwas mit dem Alter der Befragten zu tun habe und sich die Meinung ändert, wenn diese Gruppe älter wird – oder ob die Meinung beibehalten wird.
Konkrete Handlungsempfehlungen
Schon jetzt ließen sich konkrete Handlungsempfehlungen für Bildungsstätten und Kommunikationskanäle aus ihren Ergebnissen ableiten, macht sie deutlich: Man sollte mehr darauf hinweisen, dass es sich bei den Menschenrechten um universelle Rechte handelt – wenn man diese heute für eine bestimmte Gruppe einschränke, dann sei morgen vielleicht schon die nächste Gruppe dran. „Langfristig kann das negative Folgen haben, und zwar für alle. Genau das muss man den Menschen verdeutlichen“, resümiert Carey die ersten Auswertungen.
Gerade arbeitet das Team an einer zweiten Umfrage, um herauszufinden, welche Formulierung den Menschen für die Menschenrechte am sympathischsten, am schützenswertesten erscheint. Denn obwohl in Deutschland die Unterstützung der Menschenrechte prozentual gesehen noch immer sehr hoch ist, scheint es doch so zu sein, dass es für die Menschen einen noch positiveren Klang hat, wenn man diese als „demokratische Rechte“ betitelt. „Ich bin sehr gespannt darauf, was wir noch alles herausfinden mit dieser nächsten Umfrage. Vielleicht wissen wir dann, dass wenn wir die Unterstützung für Menschenrechte erhöhen möchten, wir sie künftig einfach als demokratische Rechte betiteln sollten“, sagt Carey und lächelt. Langweilig wird es jedenfalls nicht am Lehrstuhl Politikwissenschaft, Internationale Beziehungen: Im Sommer ist die Politologin viel unterwegs – auf gleich mehreren Konferenzen präsentiert sie einem Fachpublikum die bisherigen Umfrageergebnisse.
Text: Jule Leger / August 2025
