Wie viel Unklarheit verträgt die Demokratie?
Das Forschungsprojekt von Dr. Roni Lehrer zeigt: Wähler*innen erwarten von den politischen Parteien klare Ansagen – und wählen trotzdem oft das Gegenteil. Im Gespräch erklärt der Politikwissenschaftler, warum das kein Widerspruch sein muss, sondern eine demokratische Realität ist.
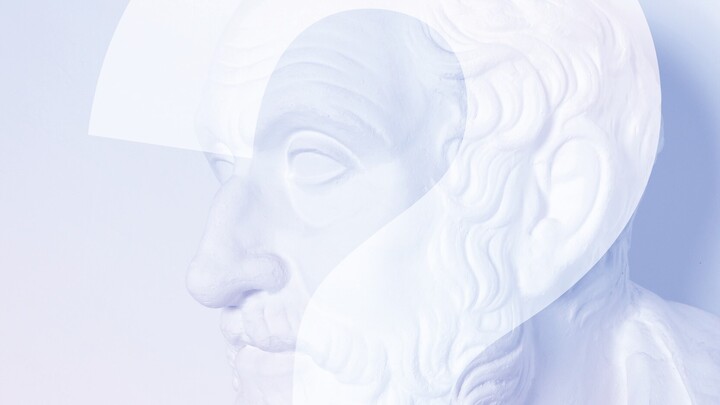
Wenn Parteien anfangen, in ihren Aussagen vage zu werden, nutzen sie häufig bestimmte Floskeln wie „Wir müssen das Thema angehen“ oder „Da braucht es einen neuen Ansatz“. Das klingt aktiv, sagt aber wenig aus. Und trotzdem: Viele Wähler*innen nicken – und machen ihr Kreuz genau dort. Wie passt das zusammen?
Dr. Roni Lehrer beschäftigt sich genau damit: Was passiert, wenn Parteien unklar sind? Bemerken Wähler*innen das überhaupt? Und wenn es ihnen auffällt: Hat das Auswirkungen auf ihr Wahlverhalten oder auf ihre Zufriedenheit mit der Demokratie? Lehrer ist Fellow und Leiter des Projekts „Unschärfe in Parteiprogrammen und ihre Auswirkungen auf politische Repräsentation und Demokratiezufriedenheit“ am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) der Universität Mannheim. Das Projekt wird von der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen ihres Eliteprogramms für Postdocs mit 135.000 Euro sowie mit 30.000 Euro vom MZES gefördert.
Der Postdoktorand bringt sein Forschungsvorhaben so auf den Punkt: „Wir schauen uns ein kleines Mosaikstück an – aber eins, das in einem viel größeren Bild wichtig ist.“ Und dieses Bild ist die Frage: Wie funktioniert unsere Demokratie und wie gut gelingt ihr der Balanceakt zwischen politischem Machterhalt und dem Willen der Bevölkerung?
Klare Worte nur unter Umständen gewünscht
Fragt man Menschen direkt, ob sie lieber klare oder unklare Aussagen von Parteien möchten, ist die Antwort deutlich: „Ich will klare Ansagen“ – das bestätigen fast alle. Bekommen sie aber vage Formulierungen zu hören, wird es paradox: Viele finden die Aussagen trotzdem gut. „Das ist nur auf den ersten Blick widersprüchlich“, sagt Lehrer.
Denn es sei hier wie so oft im Leben, erklärt er: In der Theorie seien wir alle moralisch und rational. In der Praxis entscheiden wir manchmal anders, ohne es zu merken. Lehrer fügt ein Beispiel an: „Wenn Menschen gefragt werden, ob sie klare Aussagen bevorzugen, sagen sie ja. Wenn man ihnen aber eine unklare Aussage gibt und fragt, ob sie sie gut finden, dann sagen sie auch ja – solange sie nicht merken, dass sie unklar ist.“

Drei Arten von Unklarheit
Im Zentrum von Lehrers Forschungsprojekt stehen drei typische Arten politischer Unklarheit. Zum einen sind es Widersprüche innerhalb einer Partei, wenn beispielsweise ein Parteiflügel Steuererhöhungen fordert und der andere das Gegenteil. Zum anderen geht es darum, was passiert, wenn bestimmte Themen verschwiegen werden. Ein Beispiel dafür ist die frühe AfD, die lange wenig bis gar nichts zur Sozialpolitik sagte – und sich lieber auf Migration konzentrierte. Und mit der dritten Art von Unklarheit sind vage Aussagen gemeint wie „Wir müssen an das Thema ran“.
Auffällig ist: Widersprüche und Schweigen werden eher als unklar erkannt, vage Aussagen dagegen oft nicht. Denn bei einem Widerspruch, der oft in einen internen Streit mündet, ist es offensichtlicher, dass eine Partei unklare Position bezieht. Ob Menschen die Unklarheit allerdings überhaupt bemerken, hängt stark von politischem Interesse, Vorwissen und Bildung ab. „Man muss eine gewisse Sachkenntnis über einen Sachverhalt haben, um zu verstehen, ob eine Aussage darüber konkret ist oder nicht“, erklärt der Politikwissenschaftler.
Angst vor fester Meinung
Von Unklarheit und vagen Formulierungen können Parteien also profitieren. Denn wenn sie sich nicht festlegen, können Personen in ihre Programmatik hineindeuten, was sie wollen. So erreichen die Parteien mehr Menschen. Allerdings: Wer merkt, dass da etwas nicht stimmt, fühlt sich schnell hinters Licht geführt. Und das kratzt am Vertrauen in die Politik und in die Demokratie insgesamt.
Manche Politiker*innen scheuen zudem das Risiko, sich klar festzulegen, weil sie Angst haben, dass sie angesichts veränderter Umstände ihre Meinung revidieren müssen. Beispiele dafür seien die Themen Mindestlohn oder Ehe für alle – zwei Themen, mit denen Angela Merkel zunächst haderte, sie dann aber doch umsetzte. „Man könnte sagen, dass sie umgefallen ist. Genauso gut könnte man aber sagen, dass sie ihre Meinung aufgrund neuer Mehrheiten in der Bevölkerung geändert hat. Als Demokratieforscher finde ich es nicht schlimm, wenn Politiker*innen auch einmal ihre Meinung ändern“, fasst Lehrer zusammen.
Sein Forschungsprojekt ist noch in der Analysephase. Erste Umfragedaten liegen vor, doch veröffentlicht ist noch nichts. Ein erstes Bild zeichnet sich aber ab: Unklare Aussagen entfalten ihre Wirkung vor allem dann, wenn sie nicht als unklar erkannt werden. Das vorläufige Fazit des Projektleiters ist ein realistischer Blick auf die Funktionsweise unserer Demokratie: Wähler*innen wollen Klarheit, aber sie brauchen auch die Mittel, um sie zu erkennen. Und das ist eine Frage der politischen Bildung, der Medienkompetenz – und der Ehrlichkeit in der politischen Kommunikation.
Text: Yvonne Kaul / August 2025
