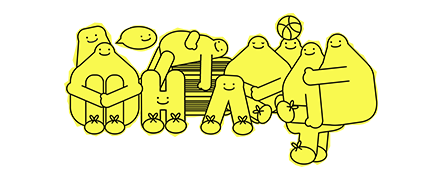Achtsamkeit im Studium
Achtsamkeit (englisch mindfulness) ist eine innere Haltung, bei der Menschen versuchen, sich selbst, die Gegenwart und das Außen mit allen Sinnen wahrzunehmen. Sie konzentrieren sich auf den gegenwärtigen Moment und begegnen ihm bewusst – jedoch ohne ihn, sich selbst oder die Umwelt zu bewerten.
Vielen Menschen fällt das schwer. Sie bewegen sich in Gedanken stark in der Vergangenheit oder beschäftigen sich häufig mit der Zukunft oder kommenden Ereignissen. Oft ziehen sie aus Vergangenem oder (möglicherweise) Kommendem Rückschlüsse auf das Hier und Jetzt.
Achtsamkeit bei Depressionen, Psychosen oder Trauma
Menschen, die unter Depressionen leiden oder eine Neigung zu Psychosen und Schizophrenie haben, sollten sich mit dem Konzept der Achtsamkeit und Achtsamkeitstechniken nur mit psychotherapeutischer Begleitung beschäftigen. Auch bei Trauma-Erfahrungen ist eine parallele therapeutische Begleitung ratsam.
Achtsamkeit und Buddhismus
Das Konzept Achtsamkeit hat seinen Ursprung im Buddhismus. Die buddhistische Lebensphilosophie besagt, dass menschliches Leid aus Unwissenheit entsteht, aber überwindbar ist. Deshalb versuchen Buddhist*innen sich von negativen Gefühlen zu befreien. Sie betrachten alle Wesen und Dinge wertfrei und sind davon überzeugt, auf diesem Weg für sich und andere Leid zu minimieren.
Meditation spielt zum Erreichen dieses ganzheitlichen Zustands im Buddhismus eine entscheidende Rolle. Die Konzentration auf den eigenen Atem während einer Meditation dient zum Beispiel dazu, die Gedanken zu beruhigen und innere Ausgeglichenheit zu erleben.
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)
Der Molekularbiologe Jon Kabat-Zinn entwickelte Ende der 1970er-Jahre ausgehend vom buddhistischen Achtsamkeitsverständnis ein umfassendes medizinisches Training zur Stressbewältigung: Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR).
Das MBSR-Programm wurde seitdem wiederholt durch Studien überprüft. Mittlerweile gilt das Achtsamkeitstraining von Jon Kabat-Zinn als wissenschaftlich erprobt und seine Wirksamkeit zur Stressreduktion als belegt.
Überblick über die Forschung im Bereich Achtsamkeit und MBSR
Ein MBSR-Kurs erstreckt sich in der Regel über mehrere Wochen. In wöchentlichen Sitzungen werden verschiedene Achtsamkeitstechniken vorgestellt und in der Gruppe praktiziert. Ohne religiösen Hintergrund verfolgt das Programm das Ziel, den persönlichen Kreislauf von Stress und Anspannung zunächst zu verstehen.
Die Teilnehmenden lernen Techniken zur Entspannung kennen, zum Beispiel Body Scan, Meditation oder achtsames Yoga und Gehen. Außerdem erproben sie Strategien, um den eigenen Gedanken und Gefühlen oder der Umwelt mit mehr Gelassenheit und Achtsamkeit zu begegnen.
Achtsame Entspannungstechniken
- Body-Scan
Der Body-Scan ist eine Technik, die hilft, das Bewusstsein für den eigenen Körper zu schulen und den eigenen Körper schrittweise zu (er)spüren. Die Wahrnehmung wird dazu systematisch von Körperteil zu Körperteil gelenkt. So werden Verspannungen, Empfindungen und Gefühle, die sich auf der Körperebene äußern, bewusster. - Atemübungen
Der Atem ist der Spiegel der Seele, heißt es oft. Wer gestresst ist, atmet tatsächlich flacher, schneller, unregelmäßiger. Bewusste Atemübungen können helfen, in stressigen Situationen gelassener zu bleiben. Zudem stärken sie effizient das Atmungssystem. - Meditation
Meditationen sind Techniken zur bewussten Steuerung der individuellen Aufmerksamkeit. Sie helfen, den Atem, Geräusche, die eigenen Gedanken oder Gefühle im Moment wahrzunehmen und diese zu beruhigen. Sie können im Sitzen oder Liegen und in unterschiedlicher Länge praktiziert werden.
Achtung: Intensive Meditationen können in bestimmten Fällen auch schwere psychische Nebenwirkungen auslösen. Vor allem emotional instabile Menschen, deren Wahrnehmung der eigenen Person oder der Umwelt verzerrt ist, sollten nicht oder nur mit ärztlicher Begleitung meditieren, betonen Ärzt*innen und Therapeut*innen.
- (Achtsames) Yoga
Yoga ist eine ganzheitliche Praxis, die das Wohlbefinden stärkt und helfen kann, Stress abzubauen. Sie stammt aus Indien und umfasst körperliche Übungen, Atemtechniken und meditative Praktiken. Es gibt viele verschiedene Yoga-Formen. Manche haben einen eher sportlichen Fokus, bei anderen steht die Verbindung von Körper und Geist im Vordergrund. Achtsames Yoga versucht, Körperübungen mit einem Bewusstsein für den eigenen Atem zu verbinden. - Progressive Muskelentspannung
Progressive Muskelentspannung ist einfach zu erlernen und die Funktionalität der Übungen ist wissenschaftlich sehr gut untersucht. Dafür werden nacheinander verschiedenen Muskelgruppen bewusst an- und wieder entspannt. Am Ende soll so ein umfassender Entspannungszustand erreicht werden. - Dankbarkeitsrituale
Dankbarkeitsrituale können helfen, sich positiven Dinge, die bestehen oder geschehen, deutlicher bewusst zu machen. Wer zum Beispiel täglich eine Tagebuch-Notiz hinterlässt, wofür er dankbar ist, verändert mit der Zeit vielleicht die Perspektive. Auch das spontane (laute) Aussprechen von Dankbarkeit im Alltag kann helfen, den Blickwinkel zu verändern.
Vorteile von Achtsamkeit im Studium
Achtsamkeit kann helfen, den gegenwärtigen Moment bewusster zu erleben und so in körperliche und geistige Entspannung und Ruhe zu kommen. Eine achtsame Haltung gegenüber den Herausforderungen des Alltags hat jedoch noch weitere Vorteile – ganz besonders im Studium:
- Selbstwahrnehmung und Selbstakzeptanz
Durch Achtsamkeit lernen wir, uns selbst und unsere Umwelt besser wahrzunehmen. Auch unsere persönlichen Grenzen und solche Situationen, die uns nicht guttun, werden uns mit der Zeit bewusster. Dieses Konzept der Selbstfürsorge fußt auf einem liebevollen und freundlichen Umgang mit sich selbst und ist besonders wertvoll, wenn es gilt, Herausforderungen zu meistern – zum Beispiel während des Studiums. - Stärkung von Mitgefühl und Empathie
Achtsame Kommunikation hilft, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen – wer bewusst zuhört, sein Gegenüber vollständig aussprechen lässt und nicht sofort urteilt, lernt Dinge aus mehreren Perspektiven zu betrachten. Andere Meinungen zuzulassen und auch bei unterschiedlichen Positionen respektvoll miteinander zu sprechen und zu diskutieren, fällt leichter. - Stressresistenz
Achtsamkeit schafft ein Bewusstsein für bestehende negative Gedankenkonstrukte. Erst wer diese erkennt, kann sie loslassen. Verschiedene Entspannungstechniken können zudem helfen, mit Prüfungsangst und Leistungsdruck auf Dauer besser umzugehen. - Gemütslage und Stimmung
Achtsamkeit kann dabei helfen, die eigenen Emotionen zu erkennen und sie zu fokussieren. So kann es gelingen, negative Emotionen aus der Vergangenheit oder über die Zukunft zu reduzieren.
- körperliche Gesundheit
Achtsamkeit hat nachgewiesen positive Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit – beispielsweise sinken Blutdruck oder Cortisolspiegel (Stresshormon). Auch das Immunsystem wird robuster und Schlafprobleme reduzieren sich. Für Prüfungsphasen besonders wichtig! - Zeitmanagement
Achtsame Planung und Priorisierung von Aufgaben erfolgt im besten Fall ohne Druck und mit viel Selbstfürsorge – zum Beispiel indem erholsame Pausen gleichwertig neben fokussierten Lernphasen stehen. - Lernphasen gut nutzen
Wer achtsam lernt, legt den Fokus auf die gegenwärtige Aufgabe und arbeitet die To Dos Schritt für Schritt ab. Wenn dennoch Gedanken kommen, lohnt es sich, sich bewusst eine definierte Dauer mit ihnen zu befassen, statt sie als störend wegzuschieben. Andernfalls bleiben die Gedanken im Hintergrund nur dauerhaft existent. - gesteigerte Konzentration
Achtsamkeitsübungen verbessern langfristig die Aufmerksamkeitsspanne. Wer achtsam ist, hat gelernt, sich auf die Gegenwart und gegenwärtige Aufgaben zu fokussieren. Die Konzentration während eines Lernblocks steigt. Wissenschaftlich belegt ist mittlerweile auch, dass vor allem Media-Multitasking sich negativ auf die Konzentrationsfähigkeit auswirkt (Minds and brains of media multitaskers).
Angebote für Studierende
In viele Fällen kann das Achtsamkeitskonzept im Umgang mit Stress gute Abhilfe schaffen. Aber es gibt auch Situationen, in denen mehr nötig ist, als der Gegenwart achtsam zu begegnen. Finanzielle Sorgen, Schicksalsschläge oder (chronische) Erkrankungen erfordern andere Methoden und eventuell kontinuierliche ärztliche Begleitung.
Beratungsangebote finden Studierende an der Universität Mannheim sowie bei kooperierenden Einrichtungen. Auch Hausärzt*innen sind gute erste Anlaufstelle und vermitteln bei Bedarf an Fachärzt*innen.
Disclaimer: Mit diesen Seiten möchten wir das Thema Mentale Gesundheit im Studium redaktionell beleuchten. Es ist Mitarbeitenden in unterschiedlichen Einrichtungen der Universität ein großes Anliegen, dass Sie körperlich und mental gesund durch Ihr Studium kommen. Damit dies besser gelingt, geben wir auf diesen Seiten Impulse. Zudem weisen wir auf Ansprechpersonen und unterstützende Angebote der Universität oder externen Stellen hin. Die hier kommunizierten Informationen, Tipps und Empfehlungen können keine Psychotherapie oder ärztliche Behandlung ersetzen. Aus diesem Grund finden Sie auf den Seiten zusätzlich Hinweise und Verlinkungen zu therapeutischen Angeboten und Notfallhilfe außerhalb der Universität Mannheim.
Wir freuen uns natürlich auch über Anmerkungen und Feedback zu den Seiten an onlineredaktionuni-mannheim.de.