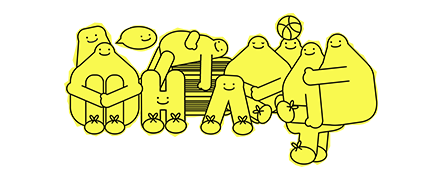Prüfungsangst im Studium
Vor einer Klausur, einer Prüfung und auch vor einem Bewerbungsgespräch fühlen viele Menschen eine natürliche Nervosität. Die Hormone Adrenalin und Cortisol werden vermehrt ausgeschüttet – wir erleben Stress. Dennoch sind die meisten Menschen auch jetzt in der Lage, die an sie gestellte Aufgabe zu meistern. Eine leichte bis mittlere Anspannung führt in vielen Fällen sogar zu einer Fokussierung und einer höheren Leistungsfähigkeit: Gelerntes wird punktgenau abgerufen.
Für einige Personen sind solche Situationen allerdings keine positiven Herausforderungen mehr, sondern sehr belastende Erlebnisse. Sie leiden unter Leistungs- oder Prüfungsangst.
Was ist Prüfungsangst?
Als Prüfungsangst bezeichnet man eine Form von Angst, die bei Schüler*innen und Studierenden, aber auch im Berufsleben auftreten kann. Vor und während einer Prüfungssituation zeigen Betroffene übermäßige und unverhältnismäßige Sorgen oder Nervosität – meist vor der Bewertung ihrer Leistung durch Dritte. Obwohl Menschen mit Prüfungsangst sich häufig intensiv vorbereiten, haben sie die reale Befürchtung, die anstehende Prüfungssituation nicht zu bestehen. Im schlimmsten Fall erleben sie aufgrund ihrer großen Angst tatsächlich einen Blackout.
Wissenschaftliche Untersuchungen gehen davon aus, dass in der Gruppe von Schüler*innen und Studierenden etwa 15 bis 30 Prozent von Prüfungsangst betroffen sind.
Wie äußert sich Prüfungsangst?
In der akuten Phase entwickeln Menschen mit Prüfungsangst häufig Symptome wie diese:
- Herzrasen, erhöhter Puls,
- Zittern, Kreislaufbeschwerden,
- Schwitzen, Schweißausbrüche,
- Konzentrations- und Gedächtnisstörungen,
- innere Unruhe,
- Gedankenkreisen,
- Magen-Darm-Beschwerden.
Der Körper von Menschen mit Prüfungsangst reagiert auf eine anstehende Klausur, einen mündlichen Leistungstest oder ein Referat so, als bestünde eine tatsächliche Bedrohung oder Gefahr: Er schaltet in den Fluchtmodus.
Menschen mit Leistungsangst fühlen sich emotional oft überfordert – nicht zuletzt aufgrund der Symptome, die sie an sich wahrnehmen. Mitunter reagieren sie aggressiv oder niedergeschlagen. Bisweilen geraten sie dabei so sehr unter Druck, dass sie in der Folge Panikattacken entwickeln.
Von klinischer Prüfungsangst sprechen Ärzt*innen, wenn sich die Angst deutlich spürbar und langfristig auf das tägliche Leben und zum Beispiel auf das universitäre oder schulische Weiterkommen auswirkt.
Bei ausgeprägter Prüfungsangst ist eine ärztliche Beratung oder eine Begleitung in Form von Gruppentrainings oder Psychotherapie ratsam. Ein verbreiteter Ansatz zur Behandlung von Prüfungsangst ist die kognitive Verhaltenstherapie. Andere Therapieformen sind zum Beispiel die tiefenpsychologische oder dynamische Psychotherapie.
Überblick über Psychotherapieverfahren (anerkannt als Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung)
Ursachen von Prüfungsangst
Die Ursachen für Prüfungsangst sind individuell. Menschen mit Prüfungsangst beschäftigen sich häufig jedoch mit sehr hohen Erwartungen an den eigenen Erfolg oder mit hohem Leistungsdruck aus dem persönlichen Umfeld. Viele Betroffene fühlen sich durch die an sie gestellten Anforderungen überfordert und verunsichert. Sie beurteilen die Prüfungssituation und ihre Kompetenzen meist viel negativer als Außenstehende dies tun würden. Manchmal führt auch eine erlebte schlechte Prüfungserfahrung erst zu einer bleibenden Angst.
Tipps für die Prüfungsvorbereitung
Wie jede Angsterkrankung verschwindet auch Prüfungsangst nicht von einem Tag auf den anderen, selbst wenn wir uns mit den eigenen Gefühlen und möglichen Bewältigungsstrategien beschäftigen. Sollte die Angst über einen längeren Zeitraum unverändert bestehen, ist es ohnehin ratsam, sich ärztliche und/
Ein paar Empfehlungen und Tipps gibt es dennoch, die helfen können, Prüfungsangst im Studium zu reduzieren und die eigene Nervosität besser zu regulieren.
- Vorbereitungen früh starten
Wer sich früh über die Prüfungsanforderungen informiert, überblickt früh, was verlangt ist, und kann gleich zu Beginn der Lernphase bestehende Unklarheiten klären. Manche Menschen lernen besser, wenn sie in einer Lerngruppe zusammenkommen oder ein Lern-Tandem bilden. Auch das am besten früh organisieren. - Lernplan aufstellen
Den Lernstoff zu strukturieren und in Abschnitte aufzuteilen, hilft einen Überblick über die To Dos zu behalten. Bei Bedarf besteht so auch die Möglichkeit, einzelne Lernziele anzupassen. Erfolgreiche Lernabschnitte können zudem abgehakt werden, was zusätzlich motivierend wirkt. - Tages- und Wochenstruktur definieren
Stundenlanges Lernen ohne Pause und Ausgleich ist nicht ratsam. Bewusste Pausen sind sehr wichtig für das körperliche und mentale Wohlbefinden: Sie helfen, neue Energie zu sammeln. Abschalten funktioniert zum Beispiel beim Sport oder bei einem Spaziergang. Auch ein Treffen mit Freund*innen kann ein wichtiger Ausgleich sein. - Entspannungstechniken nutzen
Wer mit Prüfungsangst kämpft, sollte versuchen, sonstige Anspannung und zusätzlichen Stress im Alltag zu vermeiden. Dies gelingt zum Beispiel mit Entspannungstechniken wie Achtsamkeitstraining, Progressive Muskelentspannung, Atemübungen oder Meditation.
- Positive Gedanken
Wer sich in negativen Gedankenspiralen verliert, tut sich oder der eigenen Stimmung selten etwas Gutes. Wie wäre es also damit, sich täglich bewusst einen positiven Gedanke (im Stillen oder laut) zu sagen, der motiviert. Zum Beispiel: Ich bin gut vorbereitet und werde es schaffen! - Prüfung durchspielen – „Anker“ setzen
Viele Menschen beruhigt es, eine Prüfungssituation im Vorfeld zu simulieren. So wissen sie, was in etwa auf sie zukommt. Manchmal hilft es auch, einen Notfallplan zu durchdenken. Einen „Anker zu setzen“ ist dabei eine beliebte Strategie. Dazu definiert man im Vorfeld einen Gegenstand, den man während der Prüfung nahe bei sich trägt, zum Beispiel einen Stein oder einen Ring. Fällt man in die Angst, aktiviert man den Anker, indem man den Gegenstand anfasst und bewegt. Dies hilft, die Gedankenblockade zu durchbrechen und wieder neu zu starten. - Angst annehmen
Personen, die sich mit ihrer Angst auseinandersetzen und nachvollziehen, worauf diese gründet oder welche Angstabläufe es im Körper gibt, machen sich auf den Weg zu einer Lösung. Die Angst als einen Teil von sich anzunehmen, ohne sich von ihr gänzlich definieren zu lassen, ist ein heilsamer Prozess. Manchmal ist es ausreichend, sich ohne ärztliche Hilfe mit der eigenen Vorgeschichte zu beschäftigen. In den meisten Fällen ist es jedoch besser, eine therapeutische Begleitung zur Bewältigung der eigenen Angsthistorie zu suchen.
Hilfe und Unterstützungsangebote
Disclaimer: Mit diesen Seiten möchten wir das Thema Mentale Gesundheit im Studium redaktionell beleuchten. Es ist Mitarbeitenden in unterschiedlichen Einrichtungen der Universität ein großes Anliegen, dass Sie körperlich und mental gesund durch Ihr Studium kommen. Damit dies besser gelingt, geben wir auf diesen Seiten Impulse. Zudem weisen wir auf Ansprechpersonen und unterstützende Angebote der Universität oder externen Stellen hin. Die hier kommunizierten Informationen, Tipps und Empfehlungen können keine Psychotherapie oder ärztliche Behandlung ersetzen. Aus diesem Grund finden Sie auf den Seiten zusätzlich Hinweise und Verlinkungen zu therapeutischen Angeboten und Notfallhilfe außerhalb der Universität Mannheim.
Wir freuen uns natürlich auch über Anmerkungen und Feedback zu den Seiten an onlineredaktionuni-mannheim.de.